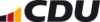Kommunalwahlen in Deutschland – Demokratie ganz nah erleben
Kommunalwahlen sind die unmittelbarste Form politischer Mitbestimmung. Hier wird entschieden, wie lebenswert Städte, Gemeinden und Landkreise sind und wer vor Ort Verantwortung übernimmt. Was genau wird gewählt, wie unterscheiden sich die Regeln in den Bundesländern, und warum lohnt es sich, die Stimme abzugeben?


- Politik, die den Alltag prägt
- Unterschiedliche Wahlsysteme in den Ländern
- Wer wählen darf – und wer kandidieren kann
- Briefwahl – bequem und sicher
- Stichwahlen
- Warum Kommunalwahlen entscheidend sind
Politik, die den Alltag prägt
Kaum eine politische Ebene hat so direkten Einfluss auf das tägliche Leben wie die Kommunalpolitik. Sie bestimmt, wie Schulen ausgestattet werden, wo neue Kitas entstehen, welche Straßen saniert werden, wie Busse und Bahnen fahren, ob Sportstätten modernisiert oder kulturelle Einrichtungen gefördert werden. Kommunalwahlen sind deshalb weit mehr als nur ein Termin im politischen Kalender – sie sind ein Instrument, um das unmittelbare Lebensumfeld aktiv mitzugestalten.
In Deutschland finden deshalb regelmäßig Kommunalwahlen statt. Die genauen Wahltermine und Regeln legt jedoch jedes Bundesland selbst fest. Das bedeutet: Während in einem Land gerade gewählt wird, steht die nächste Kommunalwahl in einem anderen Bundesland vielleicht erst in zwei oder drei Jahren an. Auch die Wahlverfahren sind nicht einheitlich – sie reichen von sehr einfachen Systemen bis zu Varianten, die mehr Auswahlmöglichkeiten bieten.
Die kommunale Ebene – vielfältig organisiert
Die Verwaltung unterhalb des Bundeslandes gliedert sich in Gemeinden, Städte, Landkreise und in manchen Fällen auch Bezirke. Gemeinden und Städte kümmern sich um Aufgaben direkt vor Ort – etwa Schulen, Kitas, Bauplanung, den Nahverkehr, Kultur, Sport und Vereine. Landkreise übernehmen Aufgaben, die mehrere Gemeinden und/ oder Städte gemeinsam betreffen, zum Beispiel den Betrieb von Krankenhäusern, Berufsschulen, die Abfallwirtschaft oder den überregionalen Busverkehr. In großen kreisfreien Städten gibt es zusätzlich Bezirke, die sich gezielt um die Anliegen einzelner Stadtteile kümmern.
In Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen gehören die Bezirke dagegen direkt zur Regierung des Bundeslandes. Das bedeutet, die Bezirksversammlungen arbeiten dort wie ein Teil der Landespolitik und sind nicht so unabhängig wie ein Stadtrat in einem Flächenland. Das macht die kommunalen Strukturen in Deutschland vielfältig und die Arbeit vor Ort umso wichtiger.
Wer entscheidet – und was bei Kommunalwahlen entschieden wird
In Gemeinden und Städten innerhalb eines Kreises wählen die Bürgerinnen und Bürger den Gemeinderat oder Stadtrat. Dieses Gremium legt den Haushalt fest, entscheidet über Bauprojekte, verabschiedet Satzungen und bestimmt, welche lokalen Initiativen gefördert werden. Gleichzeitig wird die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister direkt gewählt. Auf Kreisebene stimmen die Wählerinnen und Wähler über den Kreistag und den Landrat oder die Landrätin ab. Sie sind für Aufgaben verantwortlich, die mehrere Gemeinden oder Städte betreffen. In kreisfreien Städten wählen die Bürgerinnen und Bürger ihren Stadtrat und den Oberbürgermeister direkt. In großen kreisfreien Städten wie Köln kommt noch mehr Mitbestimmung dazu: Hier ist die Stadt in einzelne Bezirke gegliedert. Für jeden Bezirk wird eine eigene Bezirksvertretung gewählt. So haben die Menschen nicht nur Einfluss auf die Stadtpolitik, sondern auch auf Entscheidungen direkt vor ihrer Haustür.


Unterschiedliche Wahlsysteme in den Ländern
Bei einer Kommunalwahl gibt es unterschiedliche Wege, um als Kandidat in das Amt gewählt zu werden. Einige Bundesländer geben den Wählerinnen und Wählern zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Kumulieren können mehrere Stimmen auf eine einzelne Person vergeben werden, beim Panaschieren lassen sich Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Listen auswählen. So entsteht eine sehr individuelle Stimmabgabe. Andere Länder setzen auf ein einfaches System mit einer Stimme pro Kandidaten oder Liste.
Bei einer Kommunalwahl gibt es zwei Wege in den Rat zu kommen: direkt gewählt oder über die Liste. Direkt gewählt wird der Kandidat, der im Wahlbezirk die meisten Stimmen erhält. Dieser Sitz ist sicher, unabhängig vom Gesamtergebnis der Partei. Sind alle Direktmandate vergeben, werden die übrigen Sitze entsprechend dem Stimmenanteil der Parteien im gesamten Wahlgebiet verteilt. Dafür zählt die Reihenfolge auf der Liste.
Mehr Demokratie vor Ort: Integrations- und Migrationsbeiräte
In vielen Städten und Gemeinden finden am Tag der Kommunalwahl zusätzlich Wahlen zu kommunalen Integrations- und Migrationsbeiräten statt. Diese Gremien vertreten die Interessen von Menschen mit internationaler Familiengeschichte und beraten gemeinsam mit Ratsmitgliedern über integrationspolitische Fragen. Sie bringen wichtige Perspektiven in die Kommunalpolitik ein und fördern das Miteinander in der Kommune.
Wer wählen darf – und wer kandidieren kann
In fast allen Bundesländern gilt: Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist, seit einer bestimmten Zeit (meist 16 bis 3 Monate) im Wahlgebiet wohnt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und das Saarland setzen das Wahlalter allerdings erst bei 18 Jahren an. Neben deutschen Staatsbürgern dürfen auch Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten ihre Stimme abgeben, sofern sie ihren Hauptwohnsitz im Wahlgebiet haben.
Neben diesem aktiven gibt es das passive Wahlrecht. Es erlaubt, selbst kandidieren zu dürfen. Hier liegt die Altersgrenze in allen Ländern bei mindestens 18 Jahren, teils höher: In Bayern etwa müssen Bürgermeisterkandidaten 18, Landratskandidaten sogar 23 Jahre alt sein. Auch in einigen anderen Ländern gelten für bestimmte Spitzenämter höhere Altersgrenzen. Einzig Baden-Württemberg erteilt auch das passive Wahlrecht schon ab dem 16. Lebensjahr, mit Ausnahme des Bürgermeisteramtes, für das ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich ist.


Briefwahl – bequem und sicher
Die Briefwahl ist auch bei Kommunalwahlen bundesweit möglich. Sie kann schriftlich, online oder persönlich beantragt werden. Entscheidend ist: Die Wahlunterlagen müssen vollständig bis spätestens am Wahlsonntag um 16 Uhr bei der zuständigen Gemeindebehörde eingegangen sein. Wer sicher gehen will, schickt sie einige Tage vorher ab.
Stichwahlen
Wenn bei der Wahl einer Bürgermeisterin oder Bürgermeisters, einer Landrätin oder eines Landrats niemand mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, kommt es in vielen Bundesländern zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Die Details – etwa Fristen oder wer teilnehmen darf – unterscheiden sich von Land zu Land. In Berlin, Hamburg und Bremen gibt es keine Direktwahl dieser Ämter und daher auch keine Stichwahlen auf kommunaler Ebene.
Sperrklauseln: Einheitliche Regeln gibt es nicht
Eine Sperrklausel ist eine gesetzliche Mindeststimmenzahl, die erreicht werden muss, um in ein Gremium einzuziehen. In den meisten Flächenländern gibt es in der Regel keine solche Hürde. Stadtstaaten haben jedoch Ausnahmen: Berlin und Hamburg setzen auf Bezirksebene eine Drei-Prozent-Hürde, Bremen bei der Stadtbürgerschaft eine Fünf-Prozent-Hürde. Nordrhein-Westfalen kennt für Räte und Kreistage keine Sperrklausel, wohl aber eine Hürde von 2,5 Prozent für Bezirksvertretungen und das Ruhrparlament.
Warum Kommunalwahlen entscheidend sind
Kommunalwahlen bestimmen nicht nur, wer auf lokaler Ebene Entscheidungen trifft. Sie entscheiden auch darüber, ob eine Stadt oder Gemeinde handlungsfähig bleibt und ob wichtige Projekte zuverlässig umgesetzt werden. Sie beeinflussen, wie sicher Straßen sind, wie gut Schulen ausgestattet werden und wie lebendig Kultur und Vereine bleiben. Wo die CDU Verantwortung trägt, gibt es klare Prioritäten, solide Finanzen und Politik mit Weitblick. Jede Stimme für die CDU stärkt die eigene Kommune – und damit das Fundament für eine gute Zukunft.